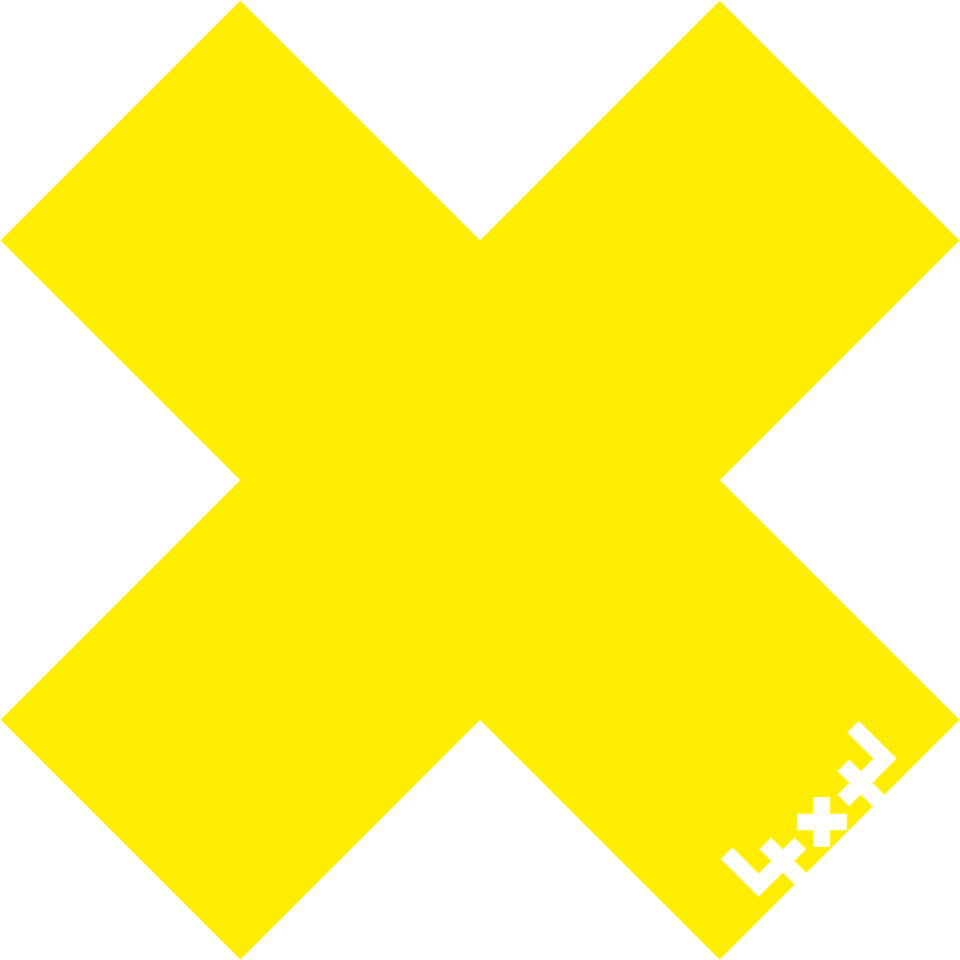Bei BMW hat Carsten Breitfeld den Hybrid-Sportwagen i8 konzipiert – und wurde dann zum Chef und Gründer des Elektroauto-Startups Byton in China. Hier erzählt er die Geschichte wie er nach China gelockt wurde, über den möglichen Einstieg eines...
Byton