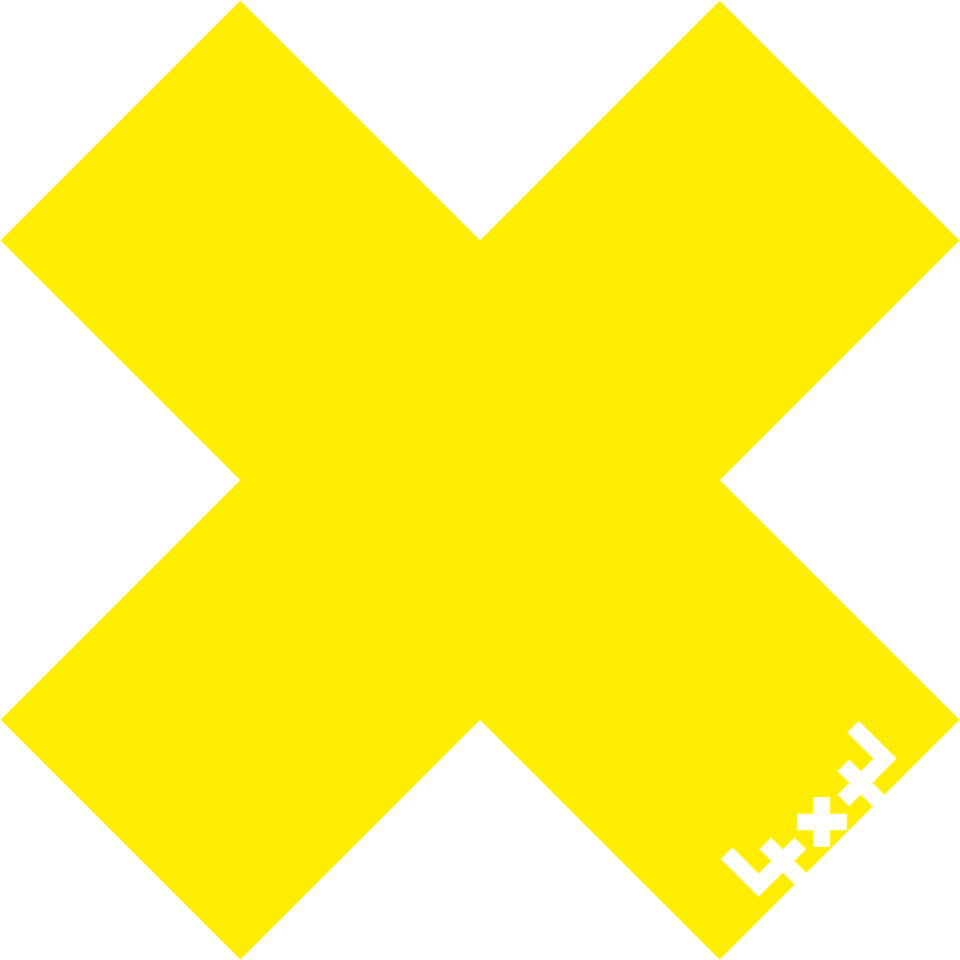Ein Team von US-Veteranen begibt sich auf eine 31‘400 Kilometer lange Fahrt von Alaska zum Darién Gap zwischen Panama und Kolumbien. Wir öffneten das sechs Meter hohe Garagentor kurz vor 3:00 Uhr morgens. Die Temperatur in der Wellblechhütte aus dem Zweiten...
I CAN, I WILL. WOMEN OVERLANDING THE WORLD
Sunny Eaton und Karin Balsley liessen erfolgreiche Karrieren und ein angenehmes Leben hinter sich, um gemeinsam die Welt zu erkunden. Beider Wunsch zu reisen entfachte sich in tiefgründigen Gesprächen wie: “Wenn wir noch sechs Monate zu leben hätten, wie sollten wir...
„Eine Büroklammer in Alaska“: Wie ich meinen Schreibtisch gegen die Wildnis eintauschte
“Wenn die Wirklichkeit einen Traum zerstören kann, warum sollte dann nicht auch ein Traum die Wirklichkeit zerstören? (George Moore)”, so beginnt das erste Kapitel der Erzählung „Eine Büroklammer in Alaska“ von Guy Grieve. Nach einem beruflichen Fehlschlag ist der...
Die grosse Reise von Alaska nach Argentinien
Nachdem wir uns erst zwei Monate zuvor getroffen hatten, brachten uns unstillbares Fernweh und spontane Abenteuerlust auf eine Idee. Zusammen würden wir den Planeten befahren. Inspiriert hatten uns die 26 Jahre Weltreise von Gunther Holtorf. Wir planten eine 350’000...