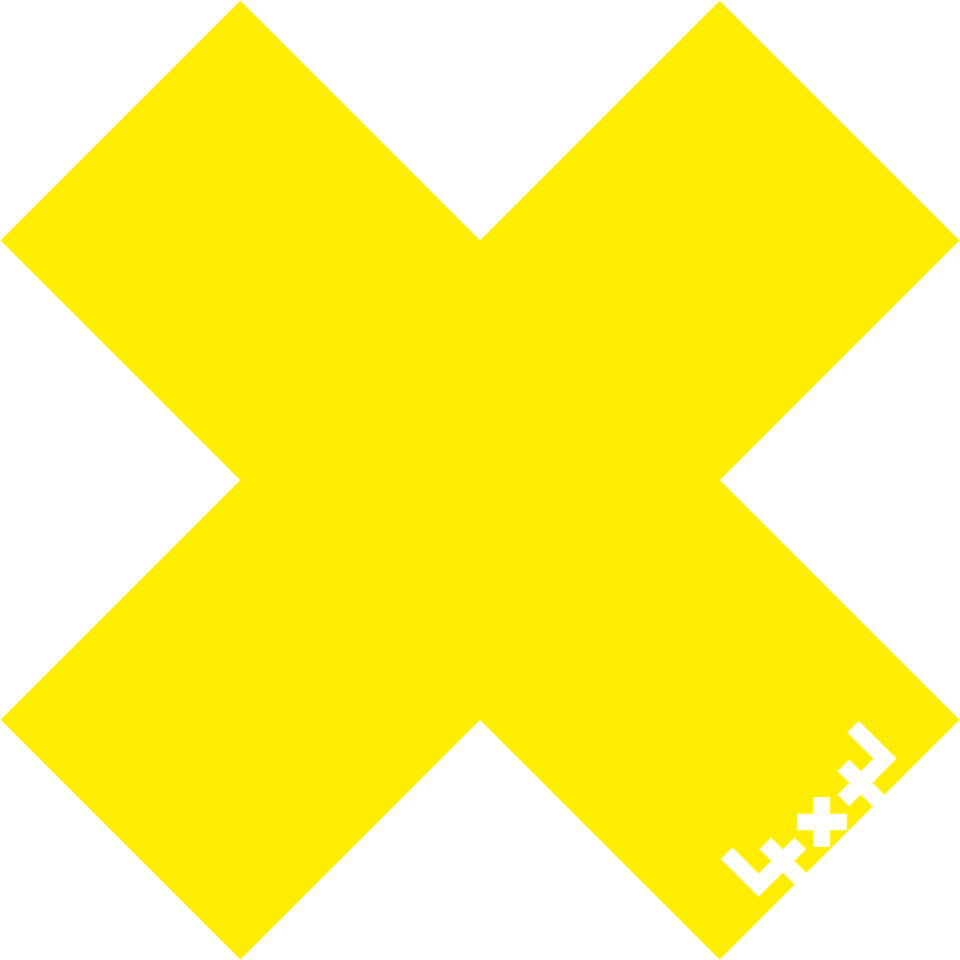Vor dem Flugzeugfenster türmen sich die Wolken wie dicke Wattebäusche auf. Am liebsten würde ich mich hineinfallen lassen. Durch eine Lücke erspähe ich weit unten das Meer. Und plötzlich sehe ich Land, ein gewaltiges Gebirge direkt unter mir. Das ist es also, das «Ende der Welt». Aotearoa – das Land der langen weissen Wolke, wie die Maori es nennen. Allmählich gehen die schroffen Klippen in grünes Farmland über. Ich lächle. Nichts und niemand erwartet mich hier. Nichts ist geplant. Niemand weiss, dass ich komme. Dieses Gefühl von Freiheit ist überwältigend. Drei Monate habe ich Zeit. «Aber ein bisschen mulmig ist dir schon?», fragt Anne, die ihre Schwester in Christchurch besuchen will und seit Sydney neben mir im Flugzeug sitzt. Ich zucke mit den Schultern. «Ein bisschen vielleicht, ja.» Die erste Nacht im Hostel in Christchurch habe ich immerhin gebucht, und das WWOOF-Buch (World Wide Opportunities on Organic Farms) steckt im Rucksack, bereit für seinen Einsatz. Ab morgen werde ich mich um einen Farmjob kümmern. Bei der Passkontrolle verabschiede ich mich von Anne.
Biosicherheitskontrolle. Ich bin erschöpft. Da ich gerade aus Indien komme, müssen meine Wanderschuhe desinfiziert werden. Sicher ist sicher. Bei der Einreise nach Neuseeland wird darauf geachtet, dass keine Keime eingeschleppt werden, die Flora und Fauna schaden könnten. Ich muss in einem Sicherheitsbereich warten, während meine Schuhe im angrenzenden Labor gründlich gereinigt werden. Neben mir muss eine Asiatin ihren gesamten Kofferinhalt ausbreiten und wird, als sie mehrere Packungen Nüsse zutage fördert, von einem Flughafenmitarbeiter zurechtgewiesen. Unter anderem dürfen Früchte, Gemüse und Nüsse nicht nach Neuseeland eingeführt werden. Der Sicherheitsangestellte kommt mit meinen Wanderschuhen in der Hand auf mich zu und verabschiedet sich mit dem Kommentar: «You look like you need some good rest.» Das stimmt. Schliesslich bin ich seit 48 Stunden unterwegs.
Nach einem Powernap im Kiwi Basecamp Hostel spaziere ich ein wenig bedrückt durch die unfertig und improvisiert wirkenden Strassen. Christchurch gleicht einer Baustelle, viele Gebäude stehen leer. Die Stadt hat etwas Geisterhaftes. Ich schlendere durch die Geschäfte im sogenannten Re:START, der provisorischen zentralen Einkaufsstrasse aus Containern. In der Nähe liegt der Cathedral Square mit der beschädigten Kathedrale ohne Turm, die als eine Art Mahnmal unrestauriert im Zentrum der Stadt steht. John, den ich in der Riccarton Mall kennenlerne, erzählt mir, wie er nach dem Erdbeben 2011 die Stadt verlassen habe, um für eine Weile bei seiner Tochter zu leben. Wie viele andere flüchtete er damals von Christchurch aufs Land. Mittlerweile sind zwar viele Menschen zurückgekehrt, doch das Stadtbild ist noch immer geprägt vom Erdbeben, dessen Ausmass Christchurch und seinen Bewohnern auch Jahre später noch sichtlich in den Knochen steckt.
Einmal rund um Neuseelands Südinsel

Erste Arbeitserfahrungen. Tags darauf reise ich zusammen mit Marion, die ich im Hostel kennengelernt habe, nach Süden auf die Banks Peninsula. Dank meines WWOOF-Buchs haben wir Marcus gefunden, der uns für ein paar Tage auf seinem kleinen Campingplatz in Little River arbeiten lässt. Wir jäten Unkraut und knacken massenhaft Walnüsse, im Gegenzug stellt er uns einen kleinen, privaten Bungalow zur Verfügung.
Als unser Arbeitssoll erfüllt ist, ziehe ich alleine weiter. In Cave, noch immer in der Region Canterbury, wartet auf einer Schaf- und Rinderfarm bereits der nächste Job auf mich. Ab Little River gibt es keine Busverbindung nach Cave, es sei denn, ich fahre zurück nach Christchurch. So entscheide ich mich fürs Trampen. Keine fünf Minuten stehe ich an der Hauptstrasse, schon nehmen mich zwei Australierinnen in ihrem Pick-up mit. Sie sind eigentlich unterwegs nach Christchurch, machen aber extra einen kleinen Umweg, damit sie mich am State Highway 1 rauslassen können, der runter in den Süden führt. Hier habe ich grössere Chancen, dass mich schnell jemand mitnimmt, meinen sie. Was bin ich den beiden dankbar, denn es hat unterdessen zu regnen begonnen.
Als Nächstes darf ich mit Tony und Claudia fahren, zwei 18-jährigen Mädels, die in einem alten Golf und Gras rauchend auf dem Weg zu einer Party in Dunedin sind. Sie sind so begeistert davon, eine Backpackerin mitzunehmen, dass sie unbedingt ein Foto mit mir machen wollen. Die Fahrt mit den beiden ist sehr kurzweilig, wir statten sogar noch Claudias Opa spontan einen Besuch ab. Ich habe Zeit und geniesse solche «Eintaucher» ins Leben der Kiwis. In Cave muss ich die letzten zwei Kilometer zur Farm zu Fuss gehen, denn leider habe ich keinen Handyempfang, und auch aus der Bar im Ort kann ich die Bäuerin nicht erreichen. Aber den ungefähren Weg bringe ich in Erfahrung. Der Wirt versichert mir: «Wenn du über die naheliegende Anhöhe gehst, wirst du den Hof bereits sehen können.» Aufgeregt mache ich mich auf den Weg.
Die 900 Hektar grosse Farm wird von Sam und Hannah bewirtschaftet. Sie züchten Angusrinder und Romney-Schafe. Sams Ausführungen zu folgen, ist eine grosse Herausforderung für mich, denn er hat einen starken neuseeländischen Akzent. Sogar Tesla, eine Wwooferin aus den USA, hat Mühe, Sams Akzent zu verstehen. Das beruhigt mich etwas.
Schon am ersten Tag dürfen wir beim «Weaning» helfen. Mit «Weaning» wird der Prozess bezeichnet, bei dem die Kälber von ihren Müttern getrennt werden. Ein lauter, anstrengender und nicht gerade ungefährlicher Job, denn keine Kuh lässt sich so ohne Weiteres von ihrem Kalb trennen. Aufs Äusserste gereizt, gehen die Mutterkühe auf die Arbeitshunde los. Ein Kalb schafft es, sich durch den Zaun zu quetschen, um wieder zurück zur Mutter zu gelangen. Eine anrührende Szene, auch wenn die Wiedervereinigung nicht von Dauer sein wird. Später werden die Jungtiere nach Geschlecht getrennt, nach Grösse geordnet und für eine Auktion in den Viehtransporter verladen. Das Leben auf der Farm ist hart, doch Hannah und Sam sind mit sehr viel Herzblut dabei. Ich sauge all diese neuen Eindrücke in mich auf, dankbar, daran teilhaben zu dürfen.
Aufs Äusserste gereizt, gehen die Mutterkühe auf die Arbeitshunde los.

Beinahe kitschig. Die abwechslungsreiche Natur beeindruckt die Autorin täglich aufs Neue.

Alpin. Wieder und wieder zieht es die Autorin hoch in die Berge – das Wetter macht nicht immer mit.

Geschafft. Tesla erholt sich in der Miller Hut von den Strapazen des Aufstiegs.
Der Aoraki, wie er von den Maori genannt wird, trägt eine Wolkenkrone, die an einen Heiligenschein erinnert.
Raue Catlins, regenreiche Fjordlands. Während der nächsten Tage fahren wir über Dunedin der Ostküste entlang gegen Süden. Wir erkunden die zerklüftete Landschaft der Catlins: endlose Sandstrände, abgeschiedene Buchten unvergessliche Tierbegegnungen und eine wilde Flora. Der Regenwald geht direkt in Strand und Meer über. So viel Schönheit können wir kaum begreifen. Es scheint tatsächlich, als hätten sich die Götter beim Erschaffen von Neuseeland besonders ausgetobt. Stundenlang beobachten wir Seelöwen und Pinguine. Alleine, ganz ohne andere Touristen links und rechts. Da die Hauptverkehrsroute durch das Inland führt, fahren hier auch keine Fernbusse vorbei. Der Himmel bei Nacht ist überwältigend – so voller Sterne, dass er nicht dunkel zu sein scheint. Die Milchstrasse ist klar erkennbar.

Unberührt. Die Catlins Coast beheimatet unzählige Tier- und Pflanzenarten, Häuser oder Siedlungen sieht man kaum.
Ich stelle mir vor, es könnte jeden Moment ein Dinosaurier um die Ecke schauen.

Morgens um fünf. Autorin Sarah Holweg beim Melken der Jerseykühe auf dem Hof von Bauer Stu.
Kühe melken. Stu ist geschieden und hat fünf erwachsene Kinder, die auf der Nordinsel und in Australien leben. Leider interessiert sich niemand von ihnen für den Hof. Er aber findet es toll, durch die Wwoofer dauernd Leute im Haus zu haben und darüber hinaus natürlich bei der Arbeit unterstützt zu werden. Gekocht wird nach getaner Arbeit immer gemeinsam und sehr lecker. Danach überrollt uns jeweils die Müdigkeit, und wir gehen früh zu Bett, schliesslich wollen die Kühe um fünf Uhr morgens schon wieder gemolken werden. Der Umgang mit der Melkmaschine klappt mit jedem Tag besser, auch dank der professionellen Einführung durch Verena, eine Wwooferin aus Österreich.
Eines Morgens bekommen einige der Kühe blaue Markierungen auf den Hintern gesprüht. «Die kommen zum Schlachter», erklärt uns Stu. Beim Melken am Abend wissen wir bei jeder Kuh, die einen blauen Hintern hat, dass wir sie nun zum letzten Mal sehen. Das stimmt mich nachdenklich. Doch das ist Stus Beruf, so verdient er nun mal seinen Lebensunterhalt.
Am nächsten Tag kommt Stus Bruder mit ein paar Freunden zum Schlachten von zwei Jungbullen vorbei. Während die Männer ihre Arbeit verrichten, gehen Verena und ich die Kälber füttern und vergessen dabei eine der Faustregeln der Farmarbeit: «Gatter immer schliessen!» Dieser Satz klingt in meinen Ohren, als Stu abends ungewöhnlich lange braucht, um die Kühe von der Weide zu holen und sie in den Melkstall zu treiben. Oje – wir haben aus Versehen ein Gatter offen gelassen. Das wird uns so schnell nicht mehr passieren.
Der Van ist Wohn-, Schlafzimmer und Küche in einem.

Abgeschiedenheit. Täglich komponieren Sarah und ihre Reisebekanntschaften die Route neu. Gecampt wird oft irgendwo im Nirgendwo.

Lecker! Verena beim Zubereiten eines Deluxe- Nachtessens.
«No Camping, No Fishing, No Swimming.» «No Breathing» – nicht atmen – hat jemand von Hand daneben gekritzelt.
Schreckmoment. Trotz aller Freiheit – die Zeit kann ich nicht anhalten. Mit jedem Tag verkürzt sich meine Reisezeit, und ich möchte noch so viel von Neuseeland sehen. Vorerst warten die Marlborough Sounds ganz im Norden der Südinsel auf uns. In Linkwater tanken wir noch einmal Benzin, denn in den Fjorden gibt es keine Tankstellen. Ein bisschen mulmig ist uns schon beim Gedanken, dass wir uns nun wieder in die unberührte Natur begeben. Zu unserer Überraschung gibt es auch hier relativ viel bewirtschaftetes Farmland. Als wir eine Pause machen, lesen wir auf einem an einen Baum genagelten Schild: «No Camping, No Fishing, No Swimming.» «No Breathing» – nicht atmen – hat jemand von Hand daneben gekritzelt. Früher, als noch weniger Touristen nach Neuseeland kamen, hat es solche Schilder wohl noch nicht gegeben.
Wir finden eine Stelle, die kein Farmland zu sein scheint und an der wir mit gutem Gewissen nächtigen können. Ganz in der Nähe campen auch zwei Einheimische. Es sind die Possumfelljäger Ed und Cory. Stu hat uns erzählt, welch grosse Plage die Possums sind. Sie verwüsten ganze Plantagen, zerstören Gärten und fressen Vogeleier in rauen Mengen. «It’s a lifestyle», sagt Ed – die beiden haben das Jagen zu ihrem Vollzeitberuf gemacht – und hält uns eines der Felle hin. Gut 100 Neuseeland-Dollar bekomme er pro Kilo, und niemand schere sich um die Tiere. Im Gegenteil, alle seien froh, wenn sich die Zahl der Millionen von Possums etwas verringere. So ziehen die beiden durchs Land, stellen Fallen auf und jagen die ungeliebten Tiere, die einst im 19. Jahrhundert zur Pelzjagd in Neuseeland eingeführt wurden. Damals hatte niemand bedacht, dass die kleinen plüschigen Tierchen, anders als in ihrer Heimat Australien, in Neuseeland keine natürlichen Feinde haben. Zudem förderte auch der neuseeländische Reichtum an schmackhaften Pflanzen ihre Vermehrung. Nun werden sie vielerorts mit dem umstrittenen Gift «1080» bekämpft, das auch der übrigen Tier- und Vogelwelt sowie den Farmern und ihrem Vieh schadet.
Tags darauf verabschieden wir uns von Ed und Cory und brechen auf, um den nahegelegenen Mount Stokes zu besteigen. Ich freue mich darauf, wieder in den Bergen zu sein, dieses Mal hoffentlich ohne Regen. Der Mount Stokes ist nur etwas über 1000 Meter hoch, und es führen verschiedene kleine Pfade auf den Gipfel. Oben angekommen – diese Wanderung ist im Vergleich zum Aufstieg zur Miller Hut ein Spaziergang –, geniessen wir die grandiose Rundumsicht. Wir überblicken die Marlborough Sounds und können am Horizont sogar die Küste der Nordinsel erkennen.

Loslassen. Vom Gipfel des Mount Stokes lassen sich die Marlborough Sounds in ihrer ganzen Schönheit überblicken.
Das Traurige am Reisen sind die vielen Abschiede.
Sarah Holweg entdeckte ihre Leidenschaft für das Reisen und andere Kulturen während eines Au-pair-Aufenthaltes in den USA. Weitere Reisen führten sie seitdem nach Neuseeland, Brasilien, Indien, Thailand, Malaysia und Botswana. Sie arbeitet als Redakteurin im Bereich Bildungsmedien und lebt in Hamburg.
Text: Sarah Holweg / Fotos: Sarah Holweg und Verena Ströhle
Die Reportage erschien erstmals im Globetrotter-Magazin Schweiz. Verpasse keine Ausgabe mehr und abonniere das Globetrotter-Magazin hier.