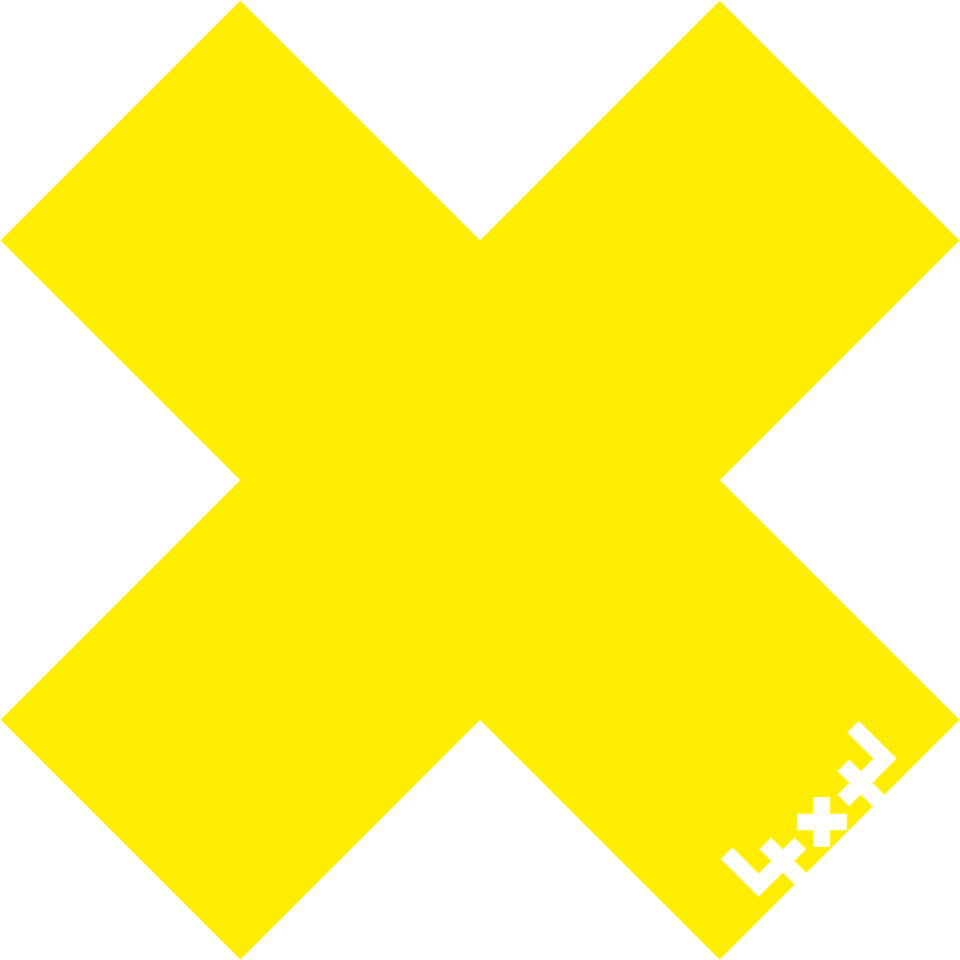Auf mein Daumen-hoch folgt zweimal Hupen, also lasse ich die Kupplung langsam kommen. Das Seil strafft sich und das zusätzliche Gewicht, das der Rubicon zieht, bemerke ich kaum im ersten Gang mit Untersetzung. Ich schleppe einen Pickup ab, voll beladen mit Lebensmitteln und Einheimischen, der an der ungünstigsten Stelle liegengeblieben ist.

Wir befinden uns auf einem schmalen, rutschigen Hügel aus Lehm mitten im dichtesten Dschungel des Kongo. Wir haben den ersten Kongo verlassen, schleichen immer noch durch das riesige Niemandsland und sind technisch stark schlecht ausgerüstet.

Langsam aber sicher geht’s bergauf, mit dem Toyota und seinen vielen Passagieren, die immer wieder gross in meinem Spiegel auftauchen. Ich kann nicht anders, ich muss grinsen, als wir über die gestrichelte Linie auf dem GPS kriechen: die internationale Grenze zwischen beiden Kongos. Ein Jeep Wrangler schleppt einen angeschlagenen Toyota Land Cruiser von Kongo zu Kongo. Ich bin mir sicher, dass die vielen Leute, die mir rieten, ich solle den Jeep verkaufen und mir einen Toyota zulegen, das nicht kommen sahen.
Im ursprünglichsten Afrika
Die Demokratische Republik Kongo (DRK), vormals Zaire, ist mit über 2,3 Mio. Quadratkilometern das Material, aus dem afrikanische Legenden gemacht sind. Wahre Epen wie Joseph Conrads Herz der Finsternis sind dort angesiedelt. Afrika wurde oft als dunkler Kontinent bezeichnet, da so viel, einschliesslich Zaire, unbekannt war, noch nicht erforscht, dargestellt durch gewaltige schwarze Flächen auf alten Landkarten. Man nimmt an, dass die heutige DRK die reichsten Mineralreserven aller Nationen weltweit besitzt; Billionen von Dollar an Diamanten, Gold und seltenen Metallen liegen unentdeckt, ebenso über fünf Milliarden Barrel Öl. Trotz dieses immensen Reichtums, oder vielleicht gerade deshalb, ist die DRK eines der gefährlichsten und am wenigsten funktionierenden Länder.
1884 versklavte König Leopold von Belgien die Region erstmals und schuf damit die Voraussetzung für eine lange Reihe zerstörerischer, plündernder und ausbeutender Zeiten. Der berüchtigte Präsident Mobutu regierte über 30 Jahre lang mit brutaler eiserner Faust und veruntreute geschätzte 15 Mrd. Dollar. Während seine Familie mit der Concorde ins Wochenende nach Paris flog, litten und starben Millionen seiner Landsleute an den Folgen seiner Grausamkeit. 1997 floh Mobutu aus dem Land und hinterliess – mit den Worten des Schriftstellers Tim Butcher – “einen wilden Zustand der Gesetzlosigkeit und Brutalität”.
Brennende Autos, Schüsse und Krawalle in Kinshasa
Die Hauptstadt Kinshasa gehört zu den 10 gefährlichsten Orten der Welt. Die Bürger protestieren gegen verschobene, jedoch versprochene Präsidentschaftswahlen. Weil er damit rechnet, abgewählt zu werden, verschiebt Präsident Kabila die Wahl auf unbestimmte Zeit. Demonstrationen in Kinshasa können schnell gewalttätig werden: Autos werden abgefackelt, Schüsse, Krawalle auf der Strasse.
Die DRK ist zwar nicht der sicherste Ort, aber man kann einige der abgelegensten und am wenigsten erforschten Regionen der Welt erkunden. Aus diesem Grund fühle ich mich seit langem angezogen und nähere mich dem Kongo mit einer Mischung aus Ehrfurcht, Respekt und Faszination.
Dem grossen Fluss Kongo entlang
Es führt kein Weg daran vorbei – um entlang der Westküste Afrikas zu fahren, muss man die DRK durchqueren. Meine Herausforderung ist es, einen sicheren Weg zu finden. Meistens ist ein so grosser Fluss wie der Kongo die internationale Grenze zwischen zwei Ländern, dies ist hier nicht der Fall. Stromabwärts von Brazzaville und Kinshasa ist der Fluss komplett in der DRK, sodass noch viele hundert Kilometer zu bewältigen sind, wenn ich erfolgreich zum Südufer gelangen will.
Nach monatelanger Recherche konzentriere ich mich auf eine selten genutzte Route, die meine Fähigkeiten und die meines Jeeps an ihre Grenzen bringen wird. Von Dolisie in der Republik Kongo werde ich Richtung Süden nach Londéla-Kayes fahren, um den ersten Kongo zu verlassen. Von dort aus plane ich, über kleinste Pfade einen Grenzübergang zu erreichen und dann hunderte von Kilometern auf praktisch nicht existierenden Schlammstrassen weiter zum mächtigen Strom zu fahren. Ich hoffe, den Fluss auf einer klapprigen Fähre überqueren zu können, wieder gefolgt von Hunderten von Kilometern Fahrt zur angolanischen Grenze.
Sollte es regnen, wird ein Durchkommen mit dem Fahrzeug nicht möglich sein. Die Gefahren sind real und die Chance, den Jeep wieder zu bergen, wenn er ernsthaft stecken bleibt, ist praktisch bei null. Eine schwere Entscheidung; die DRK ist kein Witz.
In Dolisie treffe ich meine deutschen Freunde Dani und Didi wieder; wir sind ein grossartiges Team. Wie mein Rubicon ist auch ihr robustes Sportsmobile mit einer Winde sowie mit Sperren vorne und hinten ausgestattet. Bei dem, was uns bevorsteht, sehen die 37” MT gut aus. Während wir Vorräte laden, da wir sicherlich eine Woche lang allein sein werden, bin ich erleichtert, die grösste Herausforderung meines Lebens mit Freunden zu bestreiten.
Die Fastkatastrophe zwischen Kongo und dem Niemandsland
Die schlimmsten Bedingungen erwartend, halten Didi und ich es für ratsam, den leichteren Jeep vorfahren zu lassen. Wenn ich in Schwierigkeiten gerate, kann er mich mit der Winde rückwärts herausziehen. Andersherum hätte der Jeep wohl keine Chance, das schwere Sportsmobile zu bergen.
Wir verlassen die Republik Kongo und verbringen die Nacht vor der Polizeiwache in Londéla-Kayes. Am Morgen verfällt die Strasse schnell in ein rutschiges Chaos und es dauert nicht lange, bis wir auf einen Land Cruiser treffen, der den Weg versperrt. Nach dem erfolglosen Versuch, den Toyota anzuschieben, zwänge ich mich im Jeep vorbei und ziehe das Fahrzeug über den Kamm eines Hügels; bergab lässt der Fahrer die Kupplung kommen und der Motor springt an. Nach dem Verabschieden habe ich einen Kloss im Magen, während wir tiefer ins Niemandsland eintauchen. Ich träume seit Jahren von der DRK und verspüre Aufregung, aber auch Angst. Wir haben kein Mehrfachvisum für den ersten Kongo, es gibt kein Zurück mehr.
Einige Kilometer führt der Weg durch Gras, das höher ist als der Jeep, bevor wir eine Strasse entdecken und langsam durch den Schlamm gen Süden kriechen. Ich quäle mich vorsichtig eine steile, glatte Anhöhe hinauf. Mit seinem kurzen Radstand und ohne „durchzudrehen“ ist der Jeep in der Lage, ein riesiges Loch in der Mitte der Strasse zu umgehen. Didi hat nicht so viel Glück mit seiner grösseren Spurbreite und dem höheren Gewicht. Das immense Drehmoment des grossen Diesels führt dazu, dass die Reifen durchdrehen und das Heck seitlich in das Loch gleitet.

Wir sind bald in Schweiss gebadet in der sengenden Sonne und dankbar für all das kalte Wasser, das wir in unseren Kühlboxen gelagert haben. Eine kleine Menschenmenge sammelt sich, um die Show zu sehen, alle lächeln und winken.
Hinten kämpft die Winde mit dem fast 5,5 Tonnen schweren Sportsmobile und der Jeep unter mir bockt. Ich beobachte ängstlich im Spiegel, wie ein Vorderreifen gefährlich hoch in die Luft steigt und befürchte, der Jeep könnte rückwärts rutschen.
Sehr langsam kriecht der Monster-Van vorwärts, Didi behält die Situation genau im Auge. Er kann nicht sehen, dass der hintere Reifen wieder in den Abgrund zu rutschen droht

Nachdem wir uns beruhigt haben, machen wir uns wieder an die Arbeit. Mit meiner Winde sichern wir den Jeep an einem kleinen Baum – dem einzigen weit und breit – und Didi befestigt sein Windenseil hinten am Jeep.

Als wir bereit sind, nehme ich mir einen Moment Zeit, um die Situation zu bewerten. Rechtlich gesehen sind wir in keinem Land. Weit weg von Karte und GPS, irgendwo zwischen den beiden Kongos. Ich trete so hart auf das Bremspedal, dass mein Bein krampft; der Lüfter im Jeep schaltet nicht ab, so heiss ist der Motor selbst im Leerlauf.
Ich wusste, die DRK würde eine grosse Herausforderung sein, aber wir sind noch nicht einmal da. Endlich ist der Van frei und wir räumen die Ausrüstung ein, da kommt „unser Retter von vorhin und stellt sich vor. Wir sind sehr dankbar für seine rechtzeitige Intervention – seine Antwort: “On ensemble.”
Afrika, Kontinent der Stempelkissen
Nach der erfolgreichen Bergung des Sportsmobile und weiteren tiefen Schlammlöchern erreichen wir eine grössere Siedlung. Am Ortsrand halten wir an einer provisorischen Schranke, anscheinend dem Grenzposten. Bald bildet sich eine Menschenmenge, lächelnde Kinder und Erwachsene; ich sehe mich um und spüre, dass die DRK anders ist als alles, was ich in Afrika erlebt habe. Kinder und Erwachsene zeigen offen ihre überschwängliche Freude.

Auch das Dorf ist anders – die Hauptstrasse ist breit, alle Gebäude gut gepflegt und makellos sauber. Am auffälligsten ist, dass ich zum ersten Mal in Westafrika kein einziges Stück Abfall sehe.
Lächelnd tritt ein Mann vor und heisst uns als Einwanderungsbeauftragter in seinem Land willkommen. Der schlanke Mann ist nervös und schüchtern und ich spüre, ihm ist das lange und detaillierte Einreiseformular unangenehm, das jeder von uns ausfüllen muss. Er verbringt ewig lange damit, zu erklären, wie und wo ich mein Formular ausfüllen soll, aber seine Verwirrung ist unübersehbar und er zeigt mehrmals auf die falsche Linie – dieser Mann kann weder lesen noch schreiben. Jetzt verstehe ich seine Besorgnis und versichere ihm immer wieder, dass wir seine Anweisungen genauestens befolgen.
Nach vielen Versuchen und drei identischen, zeitaufwendigen Erklärungen ist er schliesslich zufrieden und erteilt uns die Erlaubnis, ins Land einzureisen. Obwohl er stolz einen kleinen Stempel trägt, ist er nicht bereit, unsere Pässe abzustempeln; er erklärt, dass wir beim nächsten Posten Einreisestempel bekommen können.

Die gut vorbereiteten Deutschen haben ein Stempelkissen und mit Hilfe der versammelten Menge können wir den hilfsbereiten Beamten überzeugen. Wie ich in Westafrika gelernt habe, wenn du ein paar Zuschauer auf deiner Seite hast, werden dir die versammelte Menge und schliesslich die Verantwortlichen folgen.
Die Menschen behaupten, dass wir auf eine echte Strasse stossen werden und so machen wir uns auf den Weg und ignorieren das GPS. Fünf Minuten später folgen uns immer noch spielende Kinder; wir halten an und schreiben noch das Datum auf den frischen Stempel. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man in seinen eigenen Pass schreibt.
Kongo – wir sind eins
Wir fahren weiter nach Süden, auf einem überwucherten Motorradweg, durch den Dschungel. Kilometer um Kilometer schaben sich die beiden Fahrzeuge auf beiden Seiten durch das Gewirr. Als ich mit dem Kotflügel einen nicht sichtbaren Baumstumpf treffe, reisst er auseinander und fast vollständig ab. Immer wieder frage ich Dorfbewohner zu Fuss, ob dies der richtige Weg sei; ein 15-Jähriger steigt an Bord, um in die Stadt mitgenommen zu werden.

Als wir schliesslich die Ost-West-Strasse erreichen, umringen wieder Kinder die Fahrzeuge lächeln, jubeln und springen, als ob sie jeden Augenblick vor Freude platzen könnten. Mein Mitfahrer sieht seine Schwestern in der Menge und es macht Eindruck auf sie, dass er heute mit im Jeep fährt, statt zu laufen.
Auch diese Stadt ist makellos sauber; das muss daran liegen, dass man hier nichts kaufen kann, was Abfall produziert. Es gibt keinen Laden, keine Cola oder Plastiktüten und wahrscheinlich auch kein Geld, um etwas zu kaufen.
“Zum ersten Mal im Leben bin ich so fern der Zivilisation, dass es nicht einmal Müll gibt.”
Offensichtlich herrscht auf dieser Strasse mehr Verkehr, obwohl ich schnell merke, dass mehr Verkehr tiefere Furchen und längere, aufgewühlte Schlammgruben bedeutet. Die Spurrillen sind extrem tief und breiter als meine Spurweite, was mich vermuten lässt, dass hier sonst nur grosse 4×4-Trucks fahren. Wir kommen auf dem stark ausgewaschenen Pfad mit tiefem Schlamm und gelegentlichem Furten durch den Fluss nur langsam voran, wobei uns oft das Wasser bis an die Haube des Jeeps steht. Die Sonne brennt unerbittlich, bis am späten Nachmittag. Nach einem langen 14-Stunden-Tag haben wir noch kein anderes Fahrzeug gesehen.
Wir biegen auf eine kleine Nebenstrecke ab und schlagen unser Lager auf einer Lichtung ein paar hundert Meter weiter auf.

Etwa 30 Kinder und Erwachsene stehen ein paar Meter entfernt und beobachten neugierig jede unserer Bewegungen. Sie kichern vor Aufregung, als ich ihre Fragen beantworte und im Gegenzug Fragen stelle, obwohl klar ist, dass wir ihre Faszination mit uns und unseren Fahrzeugen nicht befriedigen können. Sie starren uns an, bis es stockdunkel ist – mehr als eine Stunde später.
Es ist immer noch erstaunlich heiss und feucht, als ich ins Bett klettere und versuche, Schlaf zu finden; meine erste offizielle Nacht in der DRK. Ich bin nach dem grössten und schwierigsten Expeditionstag meines Lebens völlig erschöpft, aber ich kann mir ein breites Grinsen nicht verkneifen, bevor mich die Müdigkeit übermannt.
Von einem Schlammloch ins nächste
Kurz nach Sonnenaufgang brechen wir auf, fliehen vor der Hitze des Tages und der Neugier unserer Nachbarn. Die Ost-West-Strasse macht dort weiter, wo sie gestern aufgehört hat; gelegentlich anständige Schotterstrasse, dann wieder tiefe Auswaschungen, die vorsichtig umfahren werden müssen, oder auch endlos lange Schlammgruben. Glücklicherweise sind keine der Furten zu tief und mit den Sperren vorne und hinten haben unsere Fahrzeuge keine Schwierigkeiten voranzukommen.
Am späten Nachmittag entdecke ich einen Truck am Strassenrand und nehme das zum Anlass, die Strasse ab hier für befahrbar zu halten, mit Brücken, die unser Gewicht tragen können. Didi weist zu Recht darauf hin, dass der Truck verlassen ist und wir nicht wissen, wie lange er dort schon steht.

Seit Mittag hatten sich gewaltige Sturmwolken gebildet und die ersten grossen Regentropfen schlagen auf die Windschutzscheibe ein, als uns ein alter Pickup, der im Schlamm festsitzt, den Weg versperrt. Die etwa 20 Leute auf der Pritsche können es kaum erwarten, weiterzufahren. Ich stapfe durch den knietiefen Matsch zum Fahrer, der erklärt, dass der Pickup in Ordnung ist, aber keinen Anlasser hat und sich festgefahren hat. Schnell machen wir einen Plan, der Fahrer reisst mir vor Begeisterung fast den Arm ab. Wir werden den Pickup rückwärts mit der Winde rausziehen, uns vorbei quetschen und ihn dann auf die trockene Strasse ziehen.

Unsere Geschäftigkeit dient mal wieder der allgemeinen Belustigung, während ganze Familien auf Mopeds vorbeischleichen und die Fahrer ihr Können im rutschigen Schlamm unter Beweis stellen.

Als der Pickup trockenen Boden erreicht, werden wir überschwänglich mit Dank überschüttet, alle wiederholen das Mantra „on ensemble“. Ich beobachte, wie der Pickup mit Vollgas in die nächste Schlammgrube hechtet und frage mich, wie lange es dauern mag, bis wir ihm erneut begegnen.
Aus dem Nachmittag ist früher Abend geworden und so schlagen wir hinter ein paar grossen Backsteinhäusern ein Lager auf, bevor das Licht vollständig verblasst. Die Gebäude vermitteln ein vertrautes Gefühl, das ich nicht ganz zuordnen kann, irgendwie scheint es auch nicht wichtig, denn das Wetter holt uns ein. Als das Abendessen fertig ist, geht ein Wolkenbruch monumentalen Ausmasses nieder. Ich flüchte in den Jeep und fühle mich bald wohl und entspannt. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Jeep und dem bescheidenen Wohnraum, den er bietet. Dem Wetter in Zeiten wie diesen zu entkommen, hilft mir, den Verstand nicht zu verlieren; gerne esse ich drinnen und lese ein Buch, vollkommen trocken und mückenfrei.
Kein Stempel zu viel
Mehrmals in der Nacht wecken mich Donner und der Regen, der kräftig auf das Glasfaserdach prasselt und ich staune über unsere Freunde im Pickup. Am Morgen verstehe ich endlich, hinter welchen Gebäuden wir campen, als Kinder in Uniformen auftauchen – und mich in stiller Faszination beim Kaffee kochen anstarren. Kurz darauf heisst uns ein Mann, der Lehrer nehme ich an, freundlich willkommen und versichert, es sei kein Problem, dass wir auf dem Schulhof übernachtet haben.
Als ich vor fast 10 Jahren zum ersten Mal davon träumte, Westafrika zu befahren, hatte ich eine kleine Stadt im Sinn – und seither oft an sie gedacht. Lwozi liegt am Hochufer des Kongo und ist bei Overlandern bekannt für eine der wenigen funktionierenden Fähren, die den Fluss überqueren. Ich kann nicht anders, ich muss grinsen, während ich auf der löchrigen und schlammigen Strasse herumhüpfe. Kaum zu glauben, aber ich steuere meinen Jeep tatsächlich an den Kongo.

Sobald wir in der Stadt angekommen sind, sagt ein grosser Mann in einer makellosen Militäruniform unmissverständlich, dass wir ihn zum Einwanderungsbüro begleiten müssen. Keine Bitte, sondern ein Befehl. Er ist mindestens 1,96 Meter mit breiten Schultern und seine Anordnungen dulden keinen Widerspruch. Sein Aussehen, seine strenge Art und sein finsterer Blick erinnern an einen bösen afrikanischen Warlord aus einem B-Movie. Lächeln ist ihm fremd.
Überall in der Stadt sind wir gezwungen zu warten, während der grosse Mann Partner und Assistenten anschreit, bevor er ins Einwanderungsbüro stürmt. Es kommt mir vor wie eine gross inszenierte Show zu unseren Gunsten. Zwar hat sich mein Französisch verbessert, aber ich lasse es mir nicht anmerken, wir alle tun so, als würden wir nur Englisch sprechen. Als er sich endlich beruhigt hat, beginnt er mit der sorgfältigen Prüfung jeder einzelnen Seite unserer Pässe. Schliesslich stellt er Dani Fragen, bevor er unglaublich langsam das vertraute Einreiseformular ausfüllt.
Endlich fertig, lehnt er sich mit einem triumphalen Grinsen zurück in den Stuhl. Er hält Danis Pass und das ausgefüllte Formular hoch und verkündet, dass jeder Eingangsstempel $10 kostet – stolz, die Oberhand zu haben. Auf Englisch erkläre ich sehr höflich, dass wir bereits Eingangsstempel haben und daher seine Dienste heute nicht benötigen. Ein Schreck flackert über sein Gesicht und ich sehe, wie er zögert und unsicher ist, wie er weiter vorgehen soll.
Didi versucht, die Kontrolle wiederzuerlangen, greift über den Tisch, nimmt seinen Pass und beleidigt damit den Mann. Ruhig, ohne die Stimme zu erheben, fordert der Beamte die Rückgabe des Passes, bevor er uns belehrt, dass er die Kontrolle über alle Pässe hat. Wir werden sie nur zurückbekommen, wenn und wann er es sagt, nicht eine Minute früher. Westafrika baut auf Autorität und Respekt – und wir haben es heute daran mangeln lassen.
Als alle drei Einreiseformulare ausgefüllt sind, fordert der grosse Mann noch einmal, dass wir bezahlen. Jetzt, da wir das Spiel kennen, lächeln wir alle drei und lehnen uns auf unseren Stühlen zurück, ohne ein Wort miteinander oder mit unserem Freund zu wechseln. Wir machen deutlich, dass wir alle Zeit der Welt haben und wir sind sehr froh, dass wir sie in seinem kleinen Büro verbringen können. Dem grossen Mann bleibt keine Wahl, er übergibt die Pässe und entlässt uns mit einer Handbewegung.
Zwei Pontons und ein Dieselmotor
In der Stadt schlendere ich über den kleinen Markt, um Essensvorräte zu kaufen. Der Geldwechsler ist schnell ausgemacht und wir beginnen ein Gespräch, während ich $20 in kongolesische Francs tausche. Als ich frage, wo ich Brot kaufen kann, lässt der Mann sein riesiges Bündel Geld fallen und geht mit mir über den Markt. Dass er sich dabei immer weiter von seinen ca. $10‘000 in bar entfernt, beunruhigt ihn nicht im Geringsten. Diebstahl ist hier keine Sache, erklärt er. Jeder kennt jeden und alle leben zusammen; „on ensemble“.
Nur einen Steinwurf von der Stadt entfernt, ist der Fluss erstaunlich gross, eher wie ein See. Aus der Ferne sieht er ruhig und sauber aus, aber von nahem fliesst er schnell und riecht nach Abwasser. Männer waschen ihre Mopeds an den schlammigen Ufern, während Fischer immer wieder Netze mit nichts als Plastik rausziehen.
Von der Sekunde an, in der die Fähre am Ufer anlegt, beginnt ein wütendes Gerangel: Menschen, Motorräder, Futtersäcke, Hühnerkäfige und sogar ein Hund stürmen auf das Boot. Das massive Sportsmobile steht ganz vorne, und als ich die steile Laderampe hinauffahre, bin ich erleichtert, gerade genug Platz für den Jeep zu finden.

Sobald unsere beiden Fahrzeuge an Bord sind, fährt die Fähre los; in letzter Minute kämpfen sich irgendwie noch Passagiere und Mopeds an Bord. Die Fähre besteht lediglich aus zwei mit Stahlschrott verschweissten Pontons und einem grossem Dieselmotor, der dicke Rauchwolken rülpst. Ich kaufe ein Ticket für die 20-minütige Überfahrt von einem gesprächigen Kerl, der gerne eine Quittung – nur $14 – für den Jeep und mich schreibt, ohne den Hauch von Korruption oder Inflation.
Der grosse Dieselmotor brüllt und schon bald plaudere ich mit Passagieren, der Crew und sogar dem Kapitän, der mich stolz auf seiner Brücke empfängt. Kolossale Sturmwolken ziehen sich am Horizont zusammen und Blitze treffen aufs Land. Die Temperatur des Windes auf unseren Gesichtern wechselt von erdrückend heiss zu angenehm kühl, ein sicheres Zeichen für den sich schnell nähernden Sturm.
Die freundliche Fährcrew setzt uns in einer baufälligen Barackenstadt am Südufer des Kongo ab. Ich schaue mich lange um und geniesse die Aussicht. Ich habe den Dschungel noch nicht hinter mir gelassen, aber es fühlt sich toll an zu wissen, dass nichts zwischen mir und Kapstadt an der Südspitze des Kontinents liegt. Nach ein paar hundert Metern sind wir aus der Stadt raus und kämpfen uns wieder über einen Weg voller Löcher und Schlamm. Wir sind sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind – es ist der einzige.
Zu viel für die Winde
Die Tage beginnen zu verschwimmen, während wir durch Schlammgruben kriechen, Löchern so gross wie der Jeep ausweichen und jeden Abend kleine Nebenstrecken zum Campen finden. Wir schaffen es, die schlimmsten Gewitter zu umgehen, obwohl sie jeweils ab Mittag immer am Horizont zu sehen sind.

Fahrzeuge sind selten und die, denen wir begegnen, fallen buchstäblich auseinander und sind stark überladen, mit Lebensmittelsäcken und Menschen. Eines Morgens finden wir einen schwer beladenen Transporter, der bergauf in einem kleinen Schlammloch festsitzt. Wir passieren ihn, halten an und fragen, ob sie Hilfe brauchen. Der Fahrer erklärt, dass der Truck gut läuft, aber keinen Anlasser hat und auf der kurzen Steigung stehen geblieben ist. Er ist so schwer, dass die 10 Männer, die darauf unterwegs sind, ihn nicht anschieben konnten. Seit drei Tagen liegen sie im Schatten und hoffen auf Hilfe.
Didi und ich vermuten beide, dass der Truck zu schwer ist, ziehen aber dennoch das Windenseil heraus und versuchen es. Sofort eilen die Männer aus dem Schatten, um zu helfen und uns anzufeuern, froh über die Aussicht auf Rettung. Aber Didis grosse PowerPlant-Winde gibt nur fiese Geräusche von sich und der Truck bewegt sich nicht. Leider sind wir in diesem Fall unterlegen, ich fühle mich schrecklich, erklären zu müssen, dass wir nicht helfen können.
Nicht im Geringsten verärgert, nimmt sich jeder Mann die Zeit, uns einzeln die Hand zu schütteln und zu danken. Es macht deutlich, wie sehr sie den Aufwand schätzen und ich bin mir sicher, sie hätten geholfen, wenn die Lage andersherum gewesen wäre. Obwohl sie deprimiert in den Schatten zurückkehren, war ihr Dank für unsere Bemühungen aufrichtig.
„On ensemble“ – wir zusammen
Am Ende frage ich mich, ob ganz Afrika einst so war wie die DRK jetzt: unverschämt glücklich wirkende und freundliche Menschen, die sich gegenseitig helfen und zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele unter den möglicherweise härtesten Bedingungen der Welt zu erreichen. Sie tun dies Tag für Tag, allen Widrigkeiten zum Trotz. Dass ihre gepflegten Dörfer praktisch keine Infrastruktur oder Entwicklung haben, scheint sie nicht zu stören. Sie sind so freundlich und sanft, dass ich immer das Gefühl hatte, sie wollen, dass ich um Hilfe bitte, nur damit sie sie geben können.
Ich habe unsere Durchquerung der berüchtigten DRK unter der Annahme geplant, dass wir völlig allein sein würden. Ich erwartete tagelange Schlammschlachten, dass wir uns ganz auf unseren Verstand, unsere Entschlossenheit und unsere Vorräte verlassen müssen. Ich rechnete nur mit zwei Möglichkeiten im Falle eines ernsthaften Problems: es ganz allein zu lösen oder dem Versagen ins Auge zu sehen.
Während ich mit dem Schlamm Recht behielt, lag ich völlig falsch, dass wir ganz auf uns allein gestellt waren. Selten waren wir weit entfernt von warmherzigen und grosszügigen Helfern, die sich nur allzu gerne einbrachten. Es war mir ein Vergnügen zu helfen, wenn wir konnten, und ich zweifle nicht daran, dass es umgekehrt genauso gewesen wäre. Die Kongolesen wissen, dass sie sich immer aufeinander verlassen können müssen und das verleiht ihnen Mut und Entschlossenheit, jeden zermürbenden Tag anzugehen.
Ich hoffe, dass wir als Overlander aus diesem Ansatz lernen können. Wir müssen nicht für alle Eventualitäten gerüstet sein, wenn wir ins Unbekannte aufbrechen. Als Gemeinschaft – und mit der Hilfe einiger freundlicher Einheimischer – können wir zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen, so wie Dani, Didi und ich es getan haben, um die DRK erfolgreich zu durchqueren.
Nach diesem kleinen Vorgeschmack habe ich mich in die grösste afrikanische Nation verliebt.
Fotos: Dan Grec und Dietmar Zepf, Kartografie von David Medeiros